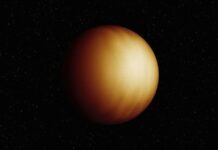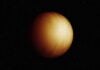Neue Untersuchungen unter Verwendung von Umwelt-DNA (eDNA) deuten darauf hin, dass sich nordische Menschen fast 70 Jahre früher als bisher angenommen in Island niederließen und dass ihre Ankunft möglicherweise nicht die ökologische Katastrophe war, als die sie oft dargestellt wird. Historische Berichte gehen typischerweise von der ersten Besiedlung in die 870er Jahre aus und erzählen von einer raschen Abholzung der Wälder, die von Wikinger-Siedlern vorangetrieben wurde, die Wälder für Treibstoff, Baumaterialien und Ackerland rodeten – ein Prozess, der dazu geführt hat, dass Island heute nur noch 2 % Waldfläche hat.
Überdenken des Zeitplans der Siedlung
Während archäologische Beweise, wie etwa ein hölzernes Langhaus aus der Zeit um 874 n. Chr., auf eine frühere Besiedlung hinweisen, war die Bestätigung des genauen Zeitrahmens eine Herausforderung. Nun analysierte ein Team um Eske Willerslev von der Universität Kopenhagen eDNA, die aus Sedimentkernen am Tjörnin-See im Zentrum von Reykjavík, einer der ältesten Siedlungen Islands, gewonnen wurde. Durch die Untersuchung von Vulkanascheschichten, die Verwendung von Radiokarbondatierungen und die Analyse von Plutoniumisotopen erstellten sie eine Zeitleiste der Region von etwa 200 n. Chr. bis zur Gegenwart.
Ein wichtiger Marker in dieser Zeitleiste ist die Landnám-Tephra-Schicht, Asche eines Vulkanausbruchs im Jahr 877 n. Chr.. Zuvor wurden die meisten Beweise für menschliche Besiedlung in Island oberhalb dieser Schicht gefunden. Die neue eDNA-Analyse weist jedoch auf Anzeichen menschlicher Aktivität unterhalb der Tephra-Schicht hin, was auf eine Besiedlung bereits im Jahr 810 n. Chr. schließen lässt. Diese Schlussfolgerung basiert auf einem Anstieg von Levoglucosan – einer Verbindung, die auf die Verbrennung von Biomasse hinweist – und einem Anstieg von Viren im Zusammenhang mit Abwasser, die beide vor dem Ausbruch im Jahr 877 vorhanden waren.
Eine differenziertere Sicht auf die Umweltauswirkungen
Entgegen der lange vertretenen Annahme einer raschen Umweltzerstörung deutet die Forschung auf ein komplexeres Bild hin. Die eDNA-Aufzeichnung zeigt einen Anstieg der Artenvielfalt, der mit der ersten Besiedlung zusammenfiel, was auf die Einführung von Weidevieh, Mähwiesen und kleinbäuerlichem Gerstenanbau – wahrscheinlich zum Brauen von Bier – hinweist. Interessanterweise zeigt die Pollenanalyse eine Ausbreitung von Birken und Weiden während der Siedlungsperiode, möglicherweise aufgrund bewusster Bewirtschaftungspraktiken, die darauf abzielen, den Zugang zu Holz sicherzustellen.
„Das ist der Sargnagel für die alte Geschichte, in der die Wikinger nach Island kamen und dann plötzlich sagten: ‚Oh nein, die Umwelt ist zerstört‘“, sagt Kathryn Catlin von der Jacksonville State University.
Während die Studie nahelegt, dass es erst nach 1200 zu einem ausgeprägten Verlust der Artenvielfalt kam, führen die Forscher diese Verschiebung auf die Klimaabkühlung während der Kleinen Eiszeit (ca. 1250–1860) zurück, die durch Vulkanausbrüche und Sturmfluten verstärkt wurde, und nicht nur auf die Aktionen der Siedler.
Es bleiben noch Fragen
Trotz der überzeugenden Ergebnisse warnen einige Experten davor, endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Fehlen konsistenter Biomarker im Zusammenhang mit menschlichen Abwässern im Laufe der vergangenen Jahrhunderte wirft Fragen über das Ausmaß und die Art der frühen Besiedlung auf. Darüber hinaus ist die Verbrennung von Biomasse oft mit menschlichen Aktivitäten verbunden, doch auch Naturereignisse wie Blitzeinschläge können Brände verursachen.
Die Forschung unterstreicht das Potenzial der eDNA-Analyse, unser Verständnis der Vergangenheit neu zu definieren und eine differenziertere Perspektive auf Islands früheste Siedler und ihre Beziehung zur Umwelt zu bieten. Dies deutet darauf hin, dass die Erzählung von den Wikinger-Siedlern, die die isländische Landschaft schnell zerstörten, möglicherweise zu stark vereinfacht ist und dass ihre anfänglichen Auswirkungen möglicherweise nachhaltiger waren als bisher angenommen.